
Der Traum von einem Schulabschluss
Mais, Kürbis, Maniok, dazu ein eigenes Haus und Frieden. Lächelnd erinnert sich die heute 15-jährige Tomasina an ihr Leben, bevor ihr Dorf von bewaffneten Männern überfallen wurde. „Unser Leben war sehr einfach. Wir hatten ein Haus und ein Feld, auf dem wir etwas Gemüse anbauten. Ich ging zur Schule und am Nachmittag half ich meiner Mutter. Es war nicht viel, aber wir waren glücklich.“
Doch was dann im Jahr 2021 begann, liest sich wie ein albtraumhafter Thriller. Das beschauliche Leben in der Provinz Cabo Delgado im Norden von Mosambik wurde durch den Ausbruch von Gewalt jäh beendet. Tausende Familien waren gezwungen, zu fliehen. „Als die Banditen in unser Dorf kamen, rannten wir sofort weg“, erinnert sich Tomasina. „Sie haben das Nachbarhaus in Brand gesetzt, und als sie uns rennen sahen, begannen sie, auf uns zu schießen. Ich hatte Angst, aber es gelang meiner Familie, zu überleben. Niemand wurde von Kugeln getroffen und wir gelangten in einen Wald.“
„Sie haben das Nachbarhaus in Brand gesetzt und begannen, auf uns zu schießen.“

Tomasina, ihre Mutter, ihr Stiefvater und ihre vier Geschwister versteckten sich monatelang im Unterholz und aßen nur noch Süßkartoffeln oder Maniok, den sie mit Wasser aus einem See kochten. Viele andere Familien hatten sich ebenfalls im Wald versteckt und halfen sich gegenseitig. An ruhigeren Tagen riskierten einige sogar die Rückkehr in ihr Dorf, um Habseligkeiten aus ihren Häusern zu retten. Währenddessen kam es in der Nähe immer wieder zu Zusammenstößen zwischen den Verteidigungs- und Sicherheitskräften sowie den „Banditen“, bewaffnete islamistische Gruppen.
Eine Flucht ins Ungewisse
Während Tomasinas Familie stets darauf hoffte, bald in ihr altes Leben zurückkehren zu können und deshalb in der Nähe ihres Dorfs blieb, entkamen Nachbarn in ganz andere Landesteile. Zaida und ihre Familie etwa flohen vor den schweren Kämpfen in Cabo Delgado bis in eine Notunterkunft. „Unsere Flucht begann zu Fuß und ohne ein Ziel. Wir wollten einfach nur an einen sicheren Ort gelangen“, erzählt die heute 16-jährige Zaida. „Wir aßen Knollen und wilde Früchte, die wir in den Wäldern entlang des Weges fanden. Da es gerade Regenzeit war, tranken wir Wasser aus Pfützen und liefen weiter.“
„Unsere Flucht begann zu Fuß. Wir wollten einfach nur an einen sicheren Ort gelangen.“

Nach drei Wochen Fußmarsch und etlichen Zwischenstopps erreichte Zaida mit ihrer Familie schließlich die Stadt Montepuez, wo sie in einem Camp für geflüchtete Menschen aus der nördlichsten Provinz Mosambiks unterkam. Die lange Zeit der Vertreibung aus ihrem angestammten Lebensumfeld stellten für sie alle eine immense Herausforderung dar.
Mitten in der Wildnis wurde die Widerstandsfähigkeit der geflüchteten Familien wie jener von Tomasina auf eine harte Probe gestellt. Und in den Notunterkünften fernab vom Konfliktherd trafen die geflüchteten Menschen auf ganz andere Herausforderungen. Sie stießen auf Ablehnung, wie Zaida erzählt:
„In dem Camp war unser Leben schwierig und das Verhältnis zur Gastgemeinde konfliktreich. Die Menschen aus der Nachbarschaft beschwerten sich darüber, dass wir Nahrungsmittelhilfe bekämen und sie dagegen nichts. Als eine Art Vergeltung erlaubten sie uns nicht, Wasser zu holen oder auf ihrem Land zu pflanzen. Es ging so weit, dass sie ihre Kinder nicht mit uns spielen ließen. Es war eine sehr schwierige Zeit, in der es sogar zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Vertriebenen und den Menschen in den Gastgemeinden kam. Zuhause hatten wir einen Fernseher und ein Motorrad, unser Haus war aus Ziegeln und komfortabel. Bevor wir weggingen, hatte mein Vater eine Farm mit Maniok-, Reis- und Maisanbau. Jetzt hatten wir nichts.“
„Bevor wir weggingen, hatte mein Vater eine Farm. Jetzt hatten wir nichts.“

Was nach einem Jahr bewaffnetem Konflikt vom Eigentum geblieben ist
„Als wir fliehen mussten, hatten wir unser Haus und all unseren Besitz zurückgelassen, ohne etwas mitzunehmen“, sagt Tomasina, die ebenso wie ihre Geschwister im Wald kaum eine Zeile lesen oder gar lernen konnte. „Ich vermisste unser altes Leben und meine Routine – die Schule, meine Freundinnen und Lehrer.“ Auch Zaida bedauert, dass sie während ihrer Flucht nicht mehr zur Schule gehen und lernen konnte: „Ich habe nicht nur meine Schule versäumt, sondern auch meine Kleidung, unseren Hausrat und mein Elternhaus verloren.“
Nach mehr als einem Jahr Vertreibungs- und Fluchterfahrung stabilisierte sich die Sicherheitslage im Norden von Mosambik. Als sich Ende 2022 herumsprach, dass viele Familien wieder auf dem Rückweg nach Hause waren, beschlossen auch Zaidas Eltern, die Notunterkunft in Montepuez zu verlassen.
„Ich vermisste unser altes Leben und meine Schule, Freundinnen und Lehrer.“
Mit den allmählich abklingenden Angriffen in Cabo Delgado, kehrte auch Tomasina mit ihrer Familie in ihre Gemeinde zurück. Das Waldstück, in dem sie sich etwa ein Jahr lang versteckt hatten, hatte ihnen trotz aller Entbehrungen ein Gefühl der Sicherheit gegeben, weil die dort lebenden Menschen schon von Weitem sehen konnten, wer sich ihnen näherte. Trotzdem lebten alle in ständiger Alarmbereitschaft für den Fall, dass sie sich abermals vor Kämpfen hätten in Sicherheit bringen müssen.
Da Tomasina nicht weit von ihrem Dorf entfernt Unterschlupf gefunden hatte, stand sie mit ihrer Familie schon bald wieder vor deren Eigenheim. „Wir waren überrascht, dass unser Haus intakt und nicht niedergebrannt worden war“, sagt das Mädchen. „Die Möbel fehlten zwar und einige Geräte waren gestohlen worden, aber sonst war alles in Ordnung.“
Für Zaida dauerte die Heimreise dagegen länger als erwartet, weil ihr Vater über das Nachbarland Tansania reisen wollte, wo er Verwandte hatte. Schließlich kam die Familie 2023 wieder in ihrem Dorf an – und die Flucht fand auch für sie ein erleichterndes Ende: „Als wir zu unserem Haus kamen, stellten wir keine größeren Schäden fest. Einige Türen waren herausgerissen und Fenster zerbrochen, aber sonst war alles unbeschadet“, sagt Zaida und ergänzt: „Ich wollte jetzt unbedingt wieder zur Schule gehen!“


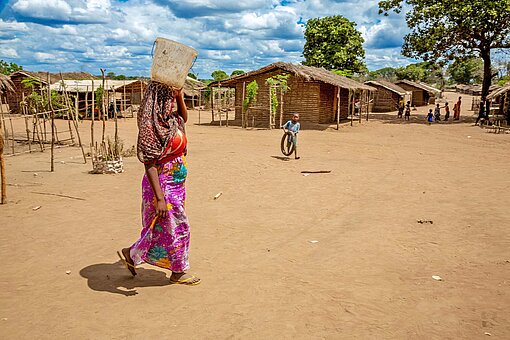
Schulbildung steht bei den heimgekehrten Mädchen ganz oben auf der Wunschliste
Um Kinder inmitten dieser vernachlässigten Krise bei der Rückkehr in den Unterricht zu unterstützen, führt Plan International in Mosambik ein entsprechendes Förderprogramm durch. Dabei wurden baufällige Klassenzimmer renoviert und neue aus lokalen Materialien errichtet, damit mehr Schulkinder geschützt und nicht unter freiem Himmel lernen können. Außerdem haben die Kinder neue Schulausstattung erhalten. „Ich war überglücklich, denn wir haben Hefte, Bücher, Mappen, Stifte und andere Schulsachen bekommen. Heute habe ich sogar eine Uniform“, sagt Tomasina. „Außerdem würde ich mir wünschen, dass mehr Toiletten zur Verfügung stehen, denn es gibt jetzt sehr viele Mädchen und Jungen an meiner Schule.“
Das von der Europäischen Union finanzierte Plan-Projekt „Bildung und Schutz in Notsituationen“ zielt darauf ab, Kindern, die vom Konflikt im Norden Mosambiks betroffen sind, den Zugang zu Bildung in einem sicheren und schützenden Umfeld zu ermöglichen. Dazu werden Schulen repariert, die durch den bewaffneten Konflikt beschädigt worden sind, und provisorische Lernräume entstehen, um den Kindern die Rückkehr zum Unterricht zu erleichtern. Im Rahmen des Projekts werden zudem Lehrkräfte ausgebildet sowie Latrinen und Waschgelegenheiten gebaut. Mobile Teams arbeiten außerdem daran, Kindern psychologische Unterstützung bei der Traumabewältigung anzubieten und ihre Eltern zu ermutigen, sie wieder in den Schulen einzuschreiben. 34.920 Mädchen und 30.385 Jungen profitieren von dem Projekt – darunter Tomasina und Zaida.


Das Leben kehrt zurück und macht Kinderrechtsverletzungen sichtbar
Nachdem die Lehrkräfte wieder da waren und der Unterricht wieder lief, kehrte nach und nach der Alltag in die umkämpften Gebiete von Cabo Delgado zurück. Das Gesundheitszentrum in Tomasinas Dorf wurde wieder in Betrieb genommen und auch die Behördenstellen arbeiten wieder.
Mit der Befriedung wurden allerdings auch die Folgen von monatelanger Flucht und Vertreibung unter der Bevölkerung sichtbar: „Ich habe etliche Freundinnen, die die Schule abgebrochen haben“, zeigt sich Tomasina besorgt. „Einige sagen, dass die Schule nichts für sie sei, andere, dass sie verheiratet oder schwanger wurden. Ich habe versucht, sie dazu zu bewegen, wieder zum Unterricht zu kommen, aber sie sagen, sie hätten keine Lust mehr zu lernen und wollten stattdessen ihren Familien helfen.“
„Wenn ich Präsidentin wäre, würde ich den Eltern sagen, dass sich ihre Kinder auf die Schule konzentrieren sollten.“
Die Kinderehe stellt eine Kinderrechtsverletzung dar
Auch und gerade in Krisenzeiten ermutigen Eltern oftmals ihre Töchter, frühzeitig zu heiraten, um die finanzielle Belastung der Familie zu verringern. „Ich halte das für falsch“, sagt Tomasina. „Wenn ich Präsidentin von Mosambik wäre, würde ich eine Versammlung einberufen, um den Eltern zu sagen, dass sich die Kinder auf die Schule konzentrieren sollten und nicht auf eine Heirat, solange sie jung sind.“
Die Entschiedenheit, mit der die 15-Jährige ihre ablehnende Meinung in diesem Punkt vertritt, ergibt sich auch aus den Veranstaltungen von Plan International, an denen sie teilgenommen hat. Dabei ging es unter anderem um die Kinderrechte und Selbstbestimmung. „Wir sollten nicht heiraten, solange wir noch Kinder sind“, erinnert sich Tomasina an das Gelernte. „Doch es gibt viele Mädchen in meinem Alter, die ältere Männer geheiratet und die Schule abgebrochen haben. Das muss aufhören.“
Tomasina selbst will fleißig weiterlernen – und später Schulleiterin werden. Und seit sich Zaida an ihrer alten Schule wieder eingeschrieben hat, träumt auch sie von einem erfolgreichen Abschluss und einer beruflichen Zukunft: Das Mädchen will Krankenschwester werden, um anderen Menschen zu helfen.
Der Artikel wurde mit Material aus dem mosambikanischen Plan-Büro erstellt.







